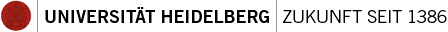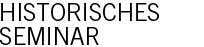Dr. Christian Alexander Neumann
Anschrift:
Dr. Christian Alexander Neumann
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK)
Historisches Seminar
Marstallstraße 6
69117 Heidelberg
Kontakt:
Büro 412 in der Außenstelle des Historischen Seminars (Marstallstraße)
Tel.: 06221-547857
E-Mail: christian.neumann@zegk.uni-heidelberg.de
Sprechstunde (WiSe 23/24): Mittwochs, 11:30-12:30 Uhr
Postanschrift:
Grabengasse 3-5
69117 Heidelberg
Forschungsschwerpunkte:
Habilitation
- Alter und Altern: historische Alter(n)sforschung; Gerontologie; Königtum; Papsttum; Dogat (Venedig); England; Kulturgeschichte; Ideengeschichte
Dissertation
- Venedig; Krone Aragon und Iberische Halbinsel; Mediterranistik; Politik und Diplomatie; Handel- und Wirtschaft; Piraterie; Mediterranistik; Soziale Netzwerkanalyse (SNA)
Curriculum Vitae:
Von 2004 bis 2010 Studium der Geschichte (Schwerpunkt Mittelalter) und Romanistik (Schwerpunkt Italienisch) an der Ruhr-Universität Bochum mit den Abschlüssen B.A. und M.A.; währenddessen Auslandsstudium an der Università degli Studi di Padova (von 2007 bis 2008); Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes (von 2005 bis 2010); von 2010 bis 2011 Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Mittelmeerstudien (ZMS) der Ruhr-Universität Bochum; von 2011 bis 2014 Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes (währenddessen auch Stipendium des Centro Tedesco di Studi Veneziani); von 2014 bis September 2017 Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte bei Prof. Dr. Nikolas Jaspert; 2015 Promotion mit einer Arbeit über die Beziehungen zwischen der Republik Venedig und der Krone Aragon im Spätmittelalter (Untersuchungsfelder Diplomatie, Handel, Piraterie), publiziert 2017 mit dem Titel „Venedig und Aragon im Spätmittelalter (1280–1410). Eine Verflechtungsgeschichte“ in der Reihe „Mittelmeerstudien“; von Oktober 2017 bis Juni 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter am DHI in Rom im Bereich Geschichte des Mittelalters zum Thema „Alte Herrscher des Mittelalters. Könige, Dogen und Päpste. Ein Beitrag zur gerontologischen Mediävistik“; seit Juli 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Heidelberg im Rahmen der Kooperationsstelle der Max Weber Stiftung.
Mitgliedschaften:
- Arbeitsgemeinschaft Iberomediävistik, Universität Heidelberg (seit 2022)
- Netzwerk Alternsforschung (NAR), Universität Heidelberg (seit 2020)
Habilitationsprojekt:
Alte Herrscher des Mittelalters: Könige, Dogen und Päpste. Ein Beitrag zu einer gerontologischen Mediävistik
Das Projekt untersucht die Altersphase mittelalterlicher Herrscher des hohen und späten Mittelalters komparatistisch aus „gerontomediävistischer“ Perspektive sowie Diskurse über Alter und Macht, welche den zeitgenössischen ideengeschichtlichen Kontext bilden. Unter „Gerontomediävistik“ wird eine spezifisch mediävistische Zugangsweise zum Wissenschaftsfeld der Gerontologie verstanden. Gerontologische Theorien, Ansätze, Konzepte und Fragestellungen werden kritisch und reflektiert auf historische Themen und Quellen appliziert. Am Beispiel der Träger politischer Macht wird die grundlegende Fragestellung untersucht, welche Relevanz der Faktor „Alter“ für die Dispositionen menschlichen Handelns besitzt. Drei bisher weitgehend getrennte Forschungstraditionen werden zusammengeführt: mediävistische Forschungen zum Alter, mediävistische Forschungen zum venezianischen Dogat, Papsttum und (englischen) Königtum sowie moderne gerontologische Forschungen. Als Fallstudien sind Herrscherpersönlichkeiten aus den Reihen der Dogen, Päpste und englischen Könige vorgesehen, die ein hohes chronologisches Alter erreichten und gleichzeitig lang regierten. In Bezug auf Venedig und das Papsttum werden wie für das Königreich England die individuellen Herrscher im Mittelpunkt stehen, doch wird auch nach der Verankerung des hohen Alters in den politischen Strukturen dieser weltlichen und kirchlichen Wahlsysteme gefragt. Drei Untersuchungsperspektiven werden verfolgt: eine diskursive (1), eine diskursiv-praxeologische (2) und eine praxeologische (3). Für jede Perspektive existiert ein spezifischer Fragenkatalog. Im Zentrum der Analyse der diskursiven Perspektive stehen Reflexionen über Alter und Macht, Repräsentationen alter Herrscher sowie Bezüge der Werke und ihrer Autoren zu Herrschern, die über die Texte selbst hinausgehen. Den Untersuchungsgegenstand der diskursiv-praxeologischen Perspektive bilden Narrative über konkrete Herrscherpersönlichkeiten, die von Diskursen mitgeprägt sind. In der praxeologischen Perspektive wird das konkrete herrscherliche Agieren in den Blick genommen und mit Diskursen und Narrativen in Beziehung gesetzt.
Abgeschlossenes Dissertationsprojekt (Monographie erschienen bei Wilhelm Fink/Ferdinand Schöning, 2017):
„Venedig und Aragon im Spätmittelalter (1280-1410): Eine Verflechtungsgeschichte"
Obwohl Venedig und Aragon die Geschicke weiter Teile des spätmittelalterlichen Mediterraneums bestimmten, ist bislang vergleichsweise wenig zu den venezianisch-katalanischen Beziehungen gearbeitet worden, In nur einer kleinen Zahl von Beiträgen stellen die Beziehungen ein autonomes Untersuchungsthema dar. Zudem sind viele Befunde disparat. Aufgrund der Forschungstradition erscheinen „Diplomatie” und „Handel” als die wesentlichen Aspekte. Jedoch resultierte, dass „Piraterie” diesen beiden gleichrangig zur Seite zu stellen ist. Daher ist die Dissertation vor allem ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Politik-, Diplomatie-, Handels- und Pirateriegeschichte. Da sich das späte 13. Jahrhundert lediglich durch punktuell intensive Kontakte zwischen Venezianern und Katalanen auszeichnet, kann erst das 14. Jahrhundert als der eigentliche Zeitraum der Genese der Beziehungen angesehen werden. Aufgrund dessen und angesichts anderer Gesichtspunkte wird ein Untersuchungszeitraum gewählt, der von etwa 1280 bis 1410 reicht. Aufgrund des defizitären Forschungsstandes wurde besonderer Wert auf intensive Quellenarbeit und vor allem Archivarbeit gelegt. Bislang wurden weder die publizierten noch die archivalischen Quellen systematisch über längere Zeiträume hinweg auf venezianisch-katalanische Kontakte hin gesichtet und ausgewertet. Zur Materialbasis zählen hauptsächlich administrative Dokumente. Die zweite wichtige Quellengruppe stellen überwiegend zeitgenössische Chroniken dar.
Ausgehend von der erwähnten Feststellung, dass Politik, Handel und Piraterie die wesentlichen Felder der venezianisch-katalanischen Beziehungen bilden, sollen sie einer eingehenden Analyse unterzogen werden. Es wird nach der Verflechtung und auch Entflechtung der drei Themenfelder untereinander gefragt. Die diachron breit angelegte Betrachtung soll Dynamiken offenbaren und Periodisierungen ermöglichen. Um die notwendige Tiefendimension zu erzielen, werden Episoden verdichteter Interaktion mikrogeschichtlich rekonstruiert. Werden Diplomatie, Handel und Piraterie unter Netzwerkansätzen betrachtet, eröffnet sich eine Vielzahl möglicher Untersuchungsaspekte. Aufgrund ihrer besonderen Relevanz sollen Akteure, Orte und Institutionen im Vordergrund stehen. Für die Analyse der Akteure wird ein prosopographischer Zugriff gewählt. Mit den Methoden der sozialen Netzwerkanalyse wird der venezianische Handel auf den Balearen zwischen 1326 und 1343/44 untersucht.
Im Folgenden sollen einige relevante Ergebnisse der Arbeit vorgestellt werden. Die Periodisierung der venezianisch-katalanischen Beziehungen ermöglicht die Differenzierung dreier markanter politischer Wendepunkte, welche die Anfänge von Phasen wachsender Verflechtung markieren und sich auch auf die Handelskontakte ausgewirkten: die „Erste Sizilianische Wende von 1282“, die „Mallorquinische Wende von 1343/44“ und die „Zweite Sizilianische Wende von 1392“. Für den venezianisch-katalanischen Handel stellten die Balearen im „langen 14. Jahrhundert“ das zentrale Emporium dar. Die Netzwerkanalyse des venezianischen Mallorcahandels offenbart, dass die Venezianer zwar dominierten, aber auch Mallorquiner darin eingebunden waren. Darüber hinaus verstärkte die Etablierung von Konsulaten die Verflechtung beider Mächte. Venedig und Aragon waren bis in die Zeit Alfonsʼ V. primär in „Freundschaft“, „Amiciciaˮ, miteinander verbunden. Deren Analyse bringt hervor, dass vier politisch-ökonomische Faktoren wesentlich zu ihrer Kontinuität beitrugen: der gemeinsame Antagonismus zu Genua, verschiedene ökonomische Hauptinteressen, wirtschaftliche Kooperation zum beiderseitigen Nutzen und die gegenseitige Respektierung der jeweiligen Einflusssphären. Obgleich Verflechtung und Konsens die Beziehungen prägten, lassen sich auch Phasen der Entflechtung bzw. reduzierter Verflechtung ausmachen. Markante Beispiele für Momente der Entflechtung und des Dissens sind zum Beispiel der einige Jahrzehnte andauernde Konflikt zwischen Venedig und der Katalanischen Kompanie und der Protektionismusstreit um 1400. Während der venezianisch-genuesischen und katalanisch-genuesischen Kriege ereigneten sich nicht nur Attacken unter den Kriegsgegnern, sondern auch Venezianer und Katalanen verübten Angriffe aufeinander. Da jeder Angriff gleichzeitig auch politische Implikationen besaß, lösten Phasen erhöhter Piraterie regelmäßig zwischenstaatliche Krisensituationen aus.
Die Untersuchung der venezianisch-katalanischen Beziehungen zeigt, dass diese nicht nur ein hohes Erkenntnispotential für die spätmittelalterliche Politik-, Handels- und Pirateriegeschichte des Mittelmeerraums besitzen, sondern in manchen Aspekten auch über diesen Raum hinausweisen.
Lehrveranstaltungen:
- Im WiSe 23/24: Quellenübung: Fürstenspiegel des frühen und hohen Mittelalters
- Im SoSe 20: Übung (Theorie u. Methode): Alter(n) im Mittelalter
- Im SoSe 17: Übung (Theorie u. Methode): Theorien und Methoden der Analyse sozialer Netzwerke
- Im WiSe 16/17: Übung (Theorie u. Methode): Generationen im Mittelalter
- Im SoSe 16: Quellenübung: Katalanen im Mittelmeerraum
- Im SoSe15: Übung (Theorie u. Methode): Soziale Netzwerkanalyse: Theorie, Methoden, Beispiele
- Im WiSe 14/15: Proseminar: Venedig im Mittelalter
Publikationen:
Monographie
Herausgeberschaften
- (Hg.), Old Age before Modernity. Case Studies and Methodological Perspectives, 500 BC‒1700 AD, Heidelberg 2023 (Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe/Pubblicazioni online del DHI Roma. Nuova serie 8).
- Nikolas Jaspert/Christian Alexander Neumann/Marco Di Branco (Hg.), Ein Meer und seine Heiligen. Hagiographie im mittelalterlichen Mediterraneum, Paderborn 2018 (Mittelmeerstudien 18).
Aufsätze
- Masculinity and Old Age in the Republic of Venice in the Middle Ages and Renaissance, in: Bea Lundt/Henry Kam Kah (Hg.), Old Age, Gender, Social Security in Africa and Europe, (Narrating (Hi)stories. Kultur und Geschichte in Afrika/Culture and History in Africa 8). [im Druck].
- Il commercio del vino tra veneziani e catalani nel Basso Medioevo, in: Michael Matheus (Hg.), Malvasia. Transfer e percezioni. Il "Commonwealth" veneziano come snodo per il commercio internazionale del vino. [im Druck]
- "Propter eius senium ac debilitatem oculorum atque visus suas horas canonicas persolvere non potest.“ Alter und Altersbilder im „Repertorium Germanicum“ und „Repertorium Poenitentiariae Germanicum“ aus gerontomediävistischer Perspektive, in: Claudia Märtl/Irmgard Fees/Andreas Rehberg/Jörg Voigt (Hg.), Die römischen Repertorien. Neue Perspektiven für die Erforschung von Kirche und Kurie des Spätmittelalters (1378–1484), Berlin-Boston 2023 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 145), S. 459–494.
- Zusammen mit Urs Brachthäuser, Seeherrschaft im westlichen Mittelmeer. Finanzierungsstrukturen, Verständnis und Wahrnehmung von Seeherrschaft am Beispiel der Krone Aragon und der Republik Genua (14. Jahrhundert), in: Nikolas Jaspert/Jan Rüdiger (Hg.), Thalassokratien im Mittelalter, Paderborn 2023 (Mittelmeerstudien 25), S. 287–326.
- Zusammen mit Jan-Hendryk de Boer/Gion Wallmeyer/Marcel Bubert/Michele Campopiano/ Vanina Kopp/Silvia Negri/Daniel Pachurka/Maximilian Schuh, Epistemische Rivalitäten. Zum Umgang mit Sonderwissen an den Höfen des 14. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 317/3 (2023), S. 572–611.
- Venezia e la Sardegna nel Basso Medioevo (secc. XIII–XV), in: RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea 12/II (giugno 2023), S. 243–273.
- Introduction. Old Age before Modernity, in: Ders. (Hg.), Old Age before Modernity. Case Studies and Methodological Perspectives, 500 BC‒1700 AD, Heidelberg 2023 (Online-Schriften des DHI Rom. Neue Reihe/Pubblicazioni online del DHI Roma, S. 1–30.
- Old Age and Rulership. King James I of Aragon and Venetian Doge Marin(o) Falier(o), in: Ders. (Hg.), Old Age before Modernity. Case Studies and Methodological Perspectives, 500 BC‒1700 AD, Heidelberg 2023 (Online-Schriften des DHI Rom, 211–239.
- The Kingdom of Mallorca and the Sea. Aspects of Medieval Iberian Maritimity Using the Example of the Two "Reintegrations" (1285‒1298 and 1343‒1349), in: Nikolas Jaspert (Hg.), Ibero-Mediävistik. Grundlagen, Potentiale und Perspektiven eines internationalen Forschungsfeldes, Münster-Berlin 2022 (Geschichte und Kultur der Iberischen Welt 17), S. 273–312.
- Perspektiven einer Gerontomediävistik, in: QFIAB 98 (2018), S. 387‒405.
Weitere Beiträge
- An Aging Warrior. King James I of Aragon, in: Ibero-Mediävistik. Mittelalterforschung zur Iberischen Halbinsel.
- Alte Herrscher des Mittelalters. Könige, Dogen, Päpste – Zwischen Umsicht, Beständigkeit und körperlich-geistigem Verfall, Themenportal der Max Weber Stiftung.
Rezensionen
- Virtus Zallot, Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli, Bologna (Il Mulino) 2021 (Biblioteca storica), in: QFIAB 102 (2022), S. 583–584.
- Dieter Girgensohn (Hg.), La fortuna dei Foscari. Silloge di documenti 1281–1530, 2 Bde., in Zusammenarbeit mit Donato Gallo und Andreas Hillerbrandt, Venezia (La Malcontenta) 2019–2020, in: QFIAB 102 (2022), S. 662–664.
- Chiara Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon governo e tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti, Bologna (Il Mulino) 2019 (Grandi illustrati), in: QFIAB 101 (2021), S. 708–710.
- Thijs Porck, Old Age in Early Medieval England. A Cultural History, Westbridge, Suffolk (Boydell & Brewer Ltd) 2019 (Anglo-Saxon Studies 33), in: QFIAB 100 (2020), S. 651–652.
- Sauro Gelichi/Stefano Gasparri (Hg.), Venice and Its Neighbors from the 8th to 11th Century. Through Renovation and Continuity, Leiden-Boston (Brill) 2018 (The Medieval Mediterranean 111), in: QFIAB 100 (2020), S. 658–659.
- Ignacio Czeghun/Cosima Möller/Yolanda María Quesada Morillas/José Antonio Pérez Juan (Hg.), Wasser ‒ Wege ‒ Wissen auf der iberischen Halbinsel.
- Longevity and Immortality. Europa – Islam – Asia, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2018 (= Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies 26), in: QFIAB 99 (2019), S. 574–575.
- Christian Scholl/Torben R. Gebhardt/Jan Clauß (Hg.), Transcultural Approaches to the Concept of Imperial Rule in the Middle Ages, Frankfurt/M. 2017, in: QFIAB 98 (2018), S. 496‒497.
- Matthias Becher (Hg.), Die mittelalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich, Ostfildern: Thorbecke 2017 (Vorträge und Forschungen/Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 84), in: QFIAB 98 (2018), S. 499‒500.
- Allegra Iafrate, The Wandering Throne of Solomon. Objects and Tales of Kingship in the Medieval Mediterranean, Leiden-Boston: Brill 2016 (Mediterranean art histories 2), in: QFIAB 98 (2018), S. 522‒523.
- Giorgio Ravegnani, Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge, Roma-Bari: Laterza 2017 (Storia e società), in: QFIAB 98 (2018), S. 576‒577.
- Stéphane Boissellier/Bernard Darbord/Denis Menjot u.a., Langues médiévales ibériques. Domaines espagnol et portuguais, Turnhout 2012 (L’atelier du médiéviste 12), in: Francia-Recensio 2016,2.
- Kerstin Hitzbleck/Klara Hübner (Hg.), Die Grenzen des Netzwerks 1200–1600, Ostfildern 2014, in: ZHF 43,3 (2016), S. 531–532.
- Nikolas Jaspert/Sebastian Kolditz (Hg.), Seeraub im Mittelmeerraum. Piraterie, Korsarentum und maritime Gewalt von der Antike bis zur Neuzeit, München u.a. 2013, in: AEM 44,2 (2014), S. 1052–1054.
- Helmut Engelhart, Lexikon zur Buchmalerei, Stuttgart 2012 (Bibliothek des Buchwesens 19), in: AEM 42,2 (2012), S. 890 (bibliographische Notiz).