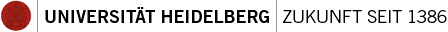Projekte
Institutsübergreifende Projekte:
European Liberal Arts Network (ELAN)
Interdisziplinärer Studien- und Forschungsverbund im Bereich der Geisteswissenschaften mit 12 europäischen Partnerhochschulen zur Förderung der internationalen Studierenden- und Dozentenmobilität, ein Projekt im Rahmen des "Baden-Württemberg-STIPENDIUMs für Studierende - BWS plus", einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung.
--> Weitere Informationen
Informationen zur Forschung in den einzelnen Instituten, erhalten Sie auf den jeweiligen Instituts-Webseiten
ZEGK-Redaktion:
E-Mail
Letzte Änderung:
16.04.2024